Bad Griesbach, Biberach, Buttenhausen - Orte der Erinnerung an Matthias Erzberger
Wegbereiter der deutschen Demokratie


Wer im Schwarzwald vom Kniebis kommend über die Alexanderschanze Richtung Rheinebene fährt, passiert auf dem Weg ins Renchtal in einer Kehre der Bundesstraße 28 oberhalb von Bad Griesbach einen schlichten Gedenkstein. Fast eine Million Auto- und Motorradfahrer kommen jedes Jahr an diesem Denkmal vorbei, das an einen politischen Mord erinnert, der 1921 die junge Weimarer Republik erschütterte.
Das Opfer dieses feigen Anschlags hieß Matthias Erzberger (1875–1921) und war einer der führenden demokratischen Politiker der Weimarer Republik. Seine steile politische Karriere bis hin zum Finanzminister und Vizekanzler war geprägt gewesen durch zahllose Konflikte, die ihre Ursachen in den Verwerfungen der deutschen Gesellschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten.
Die entsprechenden politischen und gesellschaftlichen Gegensätze bildeten nicht nur den Hintergrund für Erzbergers Ermordung, sondern prägten auch die Erinnerung an diesen führenden Vertreter der Weimarer Republik bis weit in die Zeit der Bundesrepublik hinein.
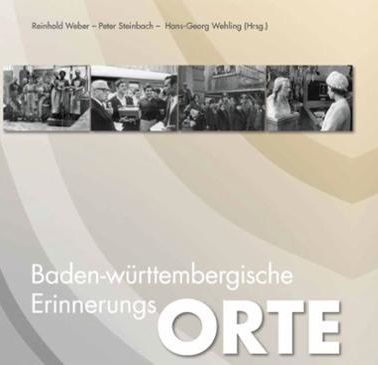
Autor: Christopher Dowe
Der Text von Christopher Dowe erschien unter dem Titel „Bad Griesbach, Biberach, Buttenhausen - Orte der Erinnerung an Matthias Erzberger, einem Wegbereiter der deutschen Demokratie“ in dem „Baden-Württembergische Erinnerungsorte“ anlässlich des 60. Jahrestages von Baden-Württemberg. Darin werden 51 Erinnerungsorte Baden-Württembergs vorgestellt.
Steile Karriere und gesellschaftliche Brüche

Erzbergers politische Wurzeln liegen im württembergischen Katholizismus. Er wurde 1875 als erster Sohn einer der wenigen katholischen Familien in (Münsingen-)Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb geboren, das zu den sogenannten Judendörfern zählte und dessen Bevölkerung je zur Hälfte evangelischen Bekenntnisses bzw. jüdischen Glaubens war. Sein sozialer Aufstieg aus einfachen Verhältnissen begann mit der Ausbildung zum Volksschullehrer, die er 1891 erfolgreich abschloss. Nach damaliger Gesetzeslage noch nicht volljährig, stürzte er sich ab 1895 auf lokaler Ebene in politische Auseinandersetzungen.
Vehement trat er für die gerade gegründete württembergische Zentrumspartei ein, die sich als katholische Volkspartei und Vertreterin der Katholiken im mehrheitlich protestantischen Württemberg verstand. Ende 1896 schied er aus dem Schuldienst aus, um sich ganz der Politik widmen zu können. Als Journalist bei der führenden katholischen Tageszeitung Württembergs, dem in Stuttgart erscheinenden „Deutschen Volksblatt“, und als „Multifunktionär“ im württembergischen Katholizismus setzte er sich neben seiner parteipolitischen Tätigkeit für den Ausbau des katholischen Vereinswesens in Württemberg und für die Entstehung interkonfessioneller christlicher Gewerkschaften ein. Katholische Arbeiter, Handwerker und Bauern beriet er und half ihnen, sich zu organisieren und ihre Interessen zu vertreten.
1903 wurde Erzberger im Wahlkreis Biberach–Leutkirch– Waldsee–Wangen in den Reichstag gewählt. Als jüngster Reichstagsabgeordneter und als einer der ersten Berufspolitiker überhaupt machte er sich einen Namen, indem er zahlreiche Skandale in der Kolonialverwaltung aufdeckte und den politisch Verantwortlichen, Ernst zu Hohenlohe-Langenburg, zum Rücktritt zwang. Damit hatte sich Erzberger den Unmut der Verwaltung zugezogen, die sich nicht von Volksvertretern im Reichstag kontrollieren lassen wollte. Zugleich hatte er einen sozialen Eklat verursacht, denn es erschien vielen unerhört, dass ein gelernter Volksschullehrer einen Hochadeligen stürzte. Der junge Zentrumspolitiker wurde schließlich auch zur Zielscheibe der politischen Rechten, denn für diese galt jegliche Kritik an der Kolonialpolitik als nationaler Verrat.
Widerstände und Gegner
Auch innerhalb seiner Fraktion stieß Erzberger auf Widerstände, setzte er doch mit Hilfe anderer süddeutscher Abgeordneter gegen Widerstände der bürgerlichen Zentrumsführung durch, dass die Interessen von katholischen Kleinbürgern, Bauern und Arbeitern aus Süd- und Südwestdeutschland stärker berücksichtigt wurden. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Erzberger so zu einem der wichtigsten Zentrumspolitiker.
Im Ersten Weltkrieg forderte Erzberger im Taumel nationaler Solidarisierung zunächst, Belgien und Teile Nordfrankreichs, aber auch eroberte Gebiete im Osten an Deutschland anzugliedern. Im Verlauf des Krieges erkannte er jedoch, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen konnte. Deshalb setzte er sich ab 1917 engagiert für einen „Verständigungsfrieden“ ein, der vorsah, mit den verschiedenen Kriegsgegnern über einen Waffenstillstand auf Augenhöhe zu verhandeln. Große Teile der Bevölkerung von der nationalen Rechten bis weit in die Reihen der Zentrumspartei hinein verweigerten sich jedoch einer realistischen Einschätzung der militärischen Lage und sahen in Erzberger und anderen Friedensbefürwortern Verräter an der nationalen Sache. Die „Dolchstoßlegende“, der zufolge der Verrat der Heimat die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg herbeigeführt habe, hat hier ihren Ursprung.
Dass Erzberger zu denjenigen gehörte, die gegen den erbitterten Widerstand des Kaisers, der Militärführung und der Konservativen im Krieg immer wieder auf mehr Einfluss und mehr Verantwortung des Parlaments drängten, trug ihm weitere Anfeindungen ein. Seine Unterschrift unter die Urkunde, mit der am 11. November 1918 in Compiègne der Waffenstillstand besiegelt und der Erste Weltkrieg beendet wurde, fügte sich für seine Gegner ebenso nahtlos in ihr Feindbild ein wie Erzbergers Bemühungen, trotz schwerster Bedenken die von den Alliierten diktierten Bedingungen des Versailler Vertrages anzunehmen, um eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen und eine Teilung Deutschlands zu vermeiden. Schließlich machte er sich bei seinen Gegnern durch seine Bemühungen verhasst, die Revolution von 1918/19 in eine parlamentarische Richtung zu lenken, mit der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten und seiner Partei eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung der Weimarer Republik zukommen zu lassen.
Hass und Ermordung

Die tiefgreifende Umgestaltung des deutschen Steuer- und Finanzwesens, die er 1919/1920 mit seiner großen Reichsfinanzreform in nur neun Monaten politisch durchsetzte, sollte nach Erzbergers Kalkül der Stabilisierung der ersten deutschen Demokratie dienen und die Kriegslasten sozial gerecht verteilen. Dass er dabei Kriegsgewinne hoch besteuern und Besitzende stärker als bisher steuerlich belasten wollte, radikalisierte die Ablehnung ihm gegenüber nur noch mehr.
Erzberger war einer der meistgehassten Politiker der frühen Weimarer Republik, den seine Gegner mit allen Mitteln ausschalten wollten. Mehrere Attentatsversuche überlebte er, bis ihn seine Mörder im Urlaub aufspürten. Entsandt hatte sie die „Organisation Consul“, eine aus einem Freikorps entstandene paramilitärische Geheimorganisation, die mit einem Attentat auf Erzberger Proteste und Aufstände linker politischer Gruppen provozieren wollte, die als Vorwand für einen antirepublikanischen Putsch rechter Kreise und der Reichswehr dienen sollten. Die Verschwörer hatten sich schon im März 1920 führend am Kapp-Lüttwitz-Putsch beteiligt. Sie sollten schließlich 1922 auch die Ermordung von Reichsaußenminister Walther Rathenau organisieren.
Zwei mordbereite Männer hatten in Berlin Erzbergers Spur aufgenommen und waren ihm in den Südwesten gefolgt. Erzberger war mit seiner Familie auf Erholungsurlaub in Griesbach (seit 1932 Bad Griesbach). Auf einem Spaziergang, den er zusammen mit einem Freund, dem Reichstagsabgeordneten Carl Diez aus Radolfzell, machte, lauerten ihm die Attentäter auf. Aus nächster Nähe schossen sie auf die beiden Politiker. Während Diez schwer verletzt überlebte, hatte Erzberger keine Chance. Tödlich getroffen stürzte er einen Abhang hinunter, wo er starb.
Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger am 26. August 1921
Matthias Erzberger war Parteipolitiker, Parlamentarier und Reichsminister in der Weimarer Republik und ein Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie. Mit seiner Unterschrift unter den Waffenstillstandsvertrag von Compiègne besiegelte er im November 1918 das Ende des Ersten Weltkriegs. Er schuf ein grundlegend neues Steuersystem - und wurde nach Hetze und Verleumdung gegen ihn am 26. August 1921 von Rechtsextremisten ermordet.
mehr
Entsetzen und Jubel – Reaktionen auf Erzbergers Ermordung

Wie tief Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gespalten war, zeigen die Reaktionen auf das Attentat. Viele Zentrumsanhänger, Liberale und Sozialdemokraten waren geschockt und organisierten zusammen mit den Gewerkschaften große Trauerkundgebungen und Protestveranstaltungen gegen die politische Gewalt von rechts. Auch die KPD beteiligte sich mancherorts. In Berlin kamen eine halbe Million Menschen zusammen, in Karlsruhe und Stuttgart waren es jeweils zehntausende. In der bayerischen Pfalz stürmten kommunistische und sozialistische Kundgebungsteilnehmer das Regierungsgebäude in Speyer und zerstörten beim „Speyerer Bildersturm“ Bildnisse der bayerischen Könige.
In Oppenau – hier wurde Erzbergers Leiche aufgebahrt – fand eine erste große Trauerfeier statt, bei der der frühere Reichskanzler Konstantin Fehrenbach und der badische Staatspräsident Gustav Trunk (beide Zentrum) sprachen. Zur Beerdigung wurde die Leiche des Ermordeten nach Biberach überführt, wo etwa 30 000 Menschen den Toten zum Grab begleiteten. Der amtierende Reichskanzler, der Badener Zentrumsmann und Reichskanzler Joseph Wirth, hielt die Leichenrede.
Ganz anders fiel die Reaktion der politischen Rechten aus. Dort gab es hemmungslosen Jubel. Nationalistische Studenten sangen „Nun danket alle Gott, für diesen braven Mord. Den Erzhalunken, scharrt ihn ein, heilig soll uns der Mörder sein, die Fahne schwarz-weiß-rot.“ Die „Oletzkoer Zeitung“ schrieb: „Erzberger, der allein Schuldige an dem schmählichen Waffenstillstand, Erzberger, der Deutschland den Versailler Schandfrieden vermittelt hat, […] hat den Lohn erhalten, der ihm als Vaterlandsverräter zukam.“ Und in München hetzte ein damals noch kaum bekannter Adolf Hitler auf einer NSDAP-Veranstaltung gegen den Ermordeten und verbreitete seine antisemitischen Hasstiraden zum Thema „Der Johannes des Judenstaates: Mathias [sic!] von Buttenhausen. Sein Werk und sein Geist.“ Diese polarisierte Deutung der Person Erzbergers sollte auch in den folgenden Jahrzehnten fortbestehen und maßgeblichen Einfluss auf die Erinnerung an den ermordeten Demokraten haben.
Umkämpfte Erinnerung

Noch am offenen Grab Erzbergers riefen die badische und die württembergische Zentrumspartei gemeinsam dazu auf, „der Väter frommer Sitte folgend“, „an der Opferstelle, an welcher unser Erzberger als politischer Märthyrer [sic] sein Blut für unsere Ideale vergossen hat“, eine schlichte Sühnekapelle zu erbauen. An der Tanne, „unter deren Ästen er sein Leben aushauchte“, sollte ein Marterl, ein Bildstock, errichtet werden. Jedes Jahr solle in Griesbach am Todestag, am 26. August, ein Seelenamt gefeiert werden.
Mit der Realisierung dieses ambitionierten Gedenkprojekts begannen südwestdeutsche Zentrumspolitiker unverzüglich. Innerhalb weniger Wochen wurde ein einfaches Marterl an der Sterbestelle errichtet. Eine Inschrift erinnerte an die Ereignisse. Im Lauf der Jahre wurde die Tanne, unter der Erzberger starb, abgeholzt, das Marterl umzäumt und schließlich mit einer kleinen Mauer umgeben. Ein eigens angelegter Waldweg bot Besuchern die Möglichkeit, von der Straße zur Sterbestelle zu gelangen. Während der Weimarer Republik fanden hier jedes Jahr am Todestag Erzbergers Gedenkfeiern der badischen Zentrumspartei statt. Bad Griesbach wurde so ein wichtiger Ort der Erinnerung an Matthias Erzberger.
Die "Erzberger-Erinnerungskapelle"

Der Bau einer Kapelle zog sich hingegen hin, hatte doch die Hyperinflation 1923 die gesammelten Spendengelder entwertet. Im Jahr 1929 wurde ein neuer Anlauf unternommen, um den Plan in die Tat umzusetzen. Führende Zentrumspolitiker wie die ehemaligen Reichskanzler Wilhelm Marx und Joseph Wirth und die badischen und württembergischen Staatspräsidenten Josef Schmitt und Eugen Bolz unterzeichneten einen neuerlichen Spendenaufruf. Ein Bauausschuss unter der Leitung von Carl Diez trieb die Errichtung einer Erzberger-Erinnerungskapelle voran. Aus Angst vor möglichen Schändungen wurde die Kapelle nicht am ursprünglich geplanten Ort des Attentats, sondern weit unterhalb auf dem Grundstück des Griesbacher Mütterholungsheimes errichtet, in dem Erzberger vor seiner Ermordung gewohnt hatte.
Der Rektor des katholischen Müttererholungsheims erklärte sich bereit, die Kapelle zu schützen. Nachdem die Bauarbeiten im Dezember 1930 endlich begonnen hatten, ging es schnell. Bereits am 20. September 1931, dem Geburtstag Erzbergers, konnte der Neubau feierlich geweiht werden. Es handelte sich um eine Sühnekapelle, die „der Sühne für [die] furchtbare Tat, dem Gebet für die Seelenruhe des Ermordeten und dem Frieden der Menschen mit Gott und unter sich“ dienen sollte.
Sie wurde Maria als „regina pacis“, als Königin des Friedens, geweiht. Das sollte daran erinnern, dass sich Erzberger für einen Verständigungsfrieden eingesetzt, mit dem Waffenstillstand von Compiègne den Krieg beendet, sich während der Revolution 1918/19 für ein Ende des Bürgerkriegs eingesetzt und die Idee eines Völkerbundes verbreitet hatte, „der die Welt vor künftigen Kriegskatastrophen zu sichern geeignet“ wäre, so die Grundsteinurkunde. In der Kapelle erinnerte ein großer Gedenkstein mit Halbrelief an den Ermordeten. Damit war zehn Jahre nach Erzbergers Ermordung die bauliche Ausstattung des Erinnerungsortes abgeschlossen.
Kirchlich-katholische Erinnerungsformen
Marterl, Sühnekapelle und Seelenopfer waren traditionelle kirchlich-katholische Elemente des Umgangs mit dem Tod. Die Erinnerung an den Toten blieb, so sehr sie auch politische Botschaften enthielt, religiös-transzendental eingebettet. Dies stellte für gläubige Katholiken eine Selbstverständlichkeit dar und bot manchem innerparteilichen Gegner Erzbergers die Möglichkeit, sich trotz früherer Konflikte am Totengedenken zu beteiligen. Für Protestanten wie für kirchlich nicht Gebundene bedeuteten diese Erinnerungsformen jedoch etwas Fremdes. Sie hatten eher ausgrenzende Wirkung. Dies schränkte die gesellschaftliche Akzeptanz des Erinnerungsortes Bad Griesbach innerhalb der Gruppe derer, die nicht nur positiv zur Weimarer Republik, sondern auch zu Erzberger standen, erheblich ein.
Während der Weimarer Republik hatte Bad Griesbach als Erinnerungsort an Matthias Erzberger in Biberach eine Konkurrenz, deren Gedenkformen ebenfalls kirchlich geprägt waren. In der oberschwäbischen Stadt hatte der langjährige Reichstagsabgeordnete ein Ehrengrab erhalten. 1922 folgte die feierliche Einweihung eines großen Denkmals auf dem Grab. Jährlich zum Todestag trafen sich Zentrumsvertreter aus der Reichstagsfraktion und dem württembergischen Landtag zu einem Requiem, zogen von der Biberacher Kirche auf den Friedhof, legten dort Kränze nieder und erinnerten in Reden an den Ermordeten. Biberach wurde so in den 1920er-Jahren "der" württembergische Erzberger-Erinnerungsort.
Mediale Vermittlung
Die Zeitungen konzentrierten während der Weimarer Republik ihre Aufmerksamkeit auf Biberach. Artikel über die dortigen Gedenkveranstaltungen überwogen. Das lag nicht nur daran, dass die Tradition der Totenehrung am Grab (und nicht an der Sterbestelle) auch von kirchlich nicht gebundenen Deutschen geteilt wurde, sondern wurde auch dadurch verstärkt, dass Erzbergers Witwe am Todestag ihres Mannes am Grab weilte und an den Biberacher Gedenkveranstaltungen teilnahm. Durch die mediale Vermittlung bekam der katholische und württembergische Erinnerungsort Biberach auch eine gewisse reichsweite Aufmerksamkeit, ohne jedoch ein nationaler Erinnerungsort zu werden. Dies verhinderte die in vielen gesellschaftlichen Gruppen fortbestehende Ablehnung gegenüber Erzberger, die seinen Tod überdauerte.
Ähnliches lässt sich im Falle Bad Griesbach beobachten. Hier spielte zwar die journalistische Berichterstattung über die Gedenkveranstaltungen eine geringe Rolle. Dafür wurde der Ort im Renchtal oft in Veröffentlichungen erwähnt, in denen Erzberger und seine Rolle im und nach dem Ersten Weltkrieg angesprochen wurde. Außerdem machten eine Vielzahl von Fotopostkarten Bad Griesbach als Sterbeort Erzbergers reichsweit bekannt. Allein zwei Dutzend Varianten solcher Fotopostkarten haben sich bis heute erhalten. So erhielt Bad Griesbach medial auch eine gewisse überregionale Bedeutung als Erinnerungsort. Wenn man jedoch genau untersucht, wer die Erinnerungsveranstaltungen vor Ort organisierte und besuchte, so war Bad Griesbach ein badischer Erinnerungsort, der fest in der Hand der badischen Zentrumspartei war.
In gewissem Sinne wies Bad Griesbach während der Weimarer Republik aber auch Merkmale eines baden-württembergischen Erinnerungsprojektes auf, das in die Zukunft des noch zu gründenden Südweststaates weisen sollte. Denn die Errichtung von Marterl und Kapelle waren bewusst gemeinsame Unternehmungen der badischen und der württembergischen Zentrumspartei, also der Teile des politischen Katholizismus, die auch in Zeiten heftigster innerparteilicher Auseinandersetzungen Erzberger immer gestützt hatten und nun gemeinsam die Erinnerung an ihn pflegen wollten.
Republikanische Erinnerungskultur und ihr Ende im Nationalsozialismus
Neben dieser spezifisch katholischen Erinnerungskultur gab es noch andere Formen der positiven Deutung Erzbergers in der Weimarer Republik, die vor allem vom „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ gepflegt wurden. Die zu dieser überparteilichen Organisation zusammengeschlossenen Sozialdemokraten, Zentrumsanhänger und Liberalen hatten sich zum Ziel gesetzt, die Weimarer Republik gegen Angriffe von links und rechts zu schützen. Dementsprechend bemühte sich das „Reichsbanner“, eine republikanische Erinnerungskultur zu fördern und zu verbreiten. Ein zentraler Teil dieser demokratischen Geschichtspolitik war es, führende Politiker der Weimarer Republik zu würdigen, die ihren Einsatz für die Demokratie mit dem Leben hatten bezahlen müssen.
So wurde oft an eine republikanische Trias, an die drei Politiker Matthias Erzberger, den 1922 ermordeten Liberalen Walther Rathenau und den Sozialdemokraten und ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert erinnert, denen „als Märtyrer der Republik“ eine Reihe von Denkmälern errichtet wurde. Im deutschen Südwesten machte sich das „Reichsbanner“ um die Erinnerung an Matthias Erzberger verdient, indem es 1927 in Buttenhausen am Geburtshaus des 1921 ermordeten Zentrumspolitikers eine Erinnerungstafel anbringen ließ.
Schändung und Zerstörung im Nationalsozialismus

Wie berechtigt es war, die Griesbacher Kapelle nicht mitten im Wald an der Sterbestelle Erzbergers, sondern in Bad Griesbach selbst zu errichten, zeigt ein Blick auf die Geschichte der „Reichsbanner“-Denkmäler. Der Hass der rechten Gegner der Weimarer Republik endete nicht mit dem Tod der drei führenden Demokraten, sondern richtete sich auch gegen die Ermordeten, in denen die verhasste Demokratie getroffen werden sollte. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass das 1926 eingeweihte Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal auf dem Hohenstein in Witten an der Ruhr bis 1933 gleich mehrfach geschändet wurde. Witten war kein Einzelfall.
Im hessischen Butzbach dauerte es 1928 nur zwei Wochen, bis die gerade errichtete Säule, deren Basis nicht nur die Gesichter der drei republikanischen Politiker, sondern auch noch das Porträt Friedrich Ludwig Weidigs, eines Revolutionärs aus dem Vormärz, zeigte, mit Teerfarbe verunstaltet wurde. In Osnabrück erfolgte die erste Schändung noch während der Bauarbeiten für das 1928 fertiggestellte Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal. Doch dies war nur ein Vorspiel. 1933 zerstörten die Nationalsozialisten systematisch die republikanischen Denkmäler.
Auch in Bad Griesbach setzen die Nationalsozialisten alles daran, die positive Erinnerungstradition an Matthias Erzberger auszulöschen. Im Sommer 1933 wurde zunächst das Marterl heimlich abgesägt. Dessen Reste verbrannte am 13. September ein 50 bis 60 Mann starker SA-Trupp und entfernte die letzten Spuren am ursprünglichen Standort. Anschließend erzwang die SA die Herausgabe des Erzberger-Gedenksteins aus der Kapelle, den der Rektor des Müttererholungsheims im Keller versteckt hatte. Noch an Ort und Stelle zerstörten sie das Epitaph. Nur das Biberacher Grabdenkmal blieb unversehrt. Die Zerstörungswelle begleitete eine intensive Hetz- und Verleumdungskampagne gegen Erzberger, bei der sich Hass auf die Weimarer Republik mit wüstem Antisemitismus verband.
Bundesrepublikanische Erinnerung an Erzberger
Nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Terrorherrschaft und dem verlorenen Zweiten Weltkrieg ließ sich nicht einfach wieder an die Erinnerungskultur der Weimarer Republik anknüpfen. Dies zeigte sich auch im Gedenken an Matthias Erzberger. Der Rektor des Bad Griesbacher Müttererholungsheims sorgte zwar dafür, dass das Epitaph in der Kapelle erneuert und dass 1951 in einer Straßenkehre unmittelbar bei der Mordstelle ein Gedenkstein als Ersatz für das zerstörte Marterl errichtet wurde. Doch die Regelmäßigkeit der Weimarer Gedenkveranstaltung ließ sich hier ebenso wenig wie in Biberach wiederbeleben.
Im regionalen Rahmen war Erzberger nicht vergessen. Die Zeitungen berichteten im Umfeld runder Geburts- oder Sterbetage und die regionale CDU veranstaltete zu diesen Anlässen kleinere Gedenkfeiern. 1961 griffen die Organisatoren noch einmal die Weimarer Tradition auf und erinnerten im größeren Rahmen. Nach einem Gedenkgottesdienst in der Erzberger-Kapelle erfolgte am Gedenkstein in der Nähe der Sterbestelle eine Kranzniederlegung. Als Gedenkredner war der damalige baden-württembergische Innenminister Filbinger gewonnen worden, der Erzberger als „redlichen Kämpfer für Frieden und Recht“ würdigte und die beiden Nachkriegszeiten verglich: „Eine totale Niederlage hat Deutschland die Probleme erspart, an denen er [Erzberger] zugrunde ging.“
Zudem wies Filbinger darauf hin, wie sehr die Hetze gegen Erzberger sowie Vorbehalte gegen Berufspolitiker und gegen den modernen Parlamentarismus in der Bundesrepublik nachwirkten und einer angemessenen Würdigung des Ermordeten im Wege standen.
Uneinigkeiten bis in die 1980er Jahre
Dass solche Anstöße zu einer positiven Erzberger-Erinnerung jenseits von Teilen der südwestdeutschen CDU kaum Resonanz fanden, hatte verschiedene Gründe. Sozialdemokraten lag der mühsame Kampf für die Erinnerung an die Verdienste von Demokraten wie Friedrich Ebert und an den sozialdemokratischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mehr am Herzen als die Person Matthias Erzbergers, der bis in den Ersten Weltkrieg hinein ein scharfer Gegner der SPD gewesen war. Filbingers Appell fand auch in seiner eigenen Partei nur eingeschränkt Resonanz. Denn die CDU erinnerte generell nur sehr zurückhaltend an die Zentrumstradition, um ihre mühsame auf- und auszubauende Interkonfessionalität nicht durch eine einseitig katholische Traditionspflege zu gefährden.
Von denen, die trotzdem an die Zentrumstradition erinnerten, standen viele in der Tradition der innerkatholischen Erzberger-Gegner, die ihn als zu „links“, zu wenig bürgerlich oder einfach als zu wenig seriös betrachtet hatten. Schließlich zeigte sich bei der CDU die Kehrseite einer bedeutenden Leistung dieser Partei, der es in einem Jahrzehnte dauernden Prozess gelang, große gesellschaftliche Gruppen an die bundesrepublikanische Demokratie zu binden, denen die Weimarer Republik und Politiker wie Erzberger verhasst gewesen waren und die zu den Trägern der NS-Herrschaft gezählt hatten.
Eine Wende vollzog sich in den 1980er-Jahren, als nicht nur eine Reihe von Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmälern von lokalen Geschichtsinitiativen wieder errichtet wurden, sondern als sich auch allmählich in einem anderen Zusammenhang die Erzberger-Erinnerung belebte. Der Vorsitzende des Dettinger Wilhelm-und-Lousie-Zimmermann-Geschichtsvereins Günter Randecker trug (und trägt bis heute) mit einer Vielzahl von Vorträgen und kleinen Ausstellungen vor allem, aber nicht nur in Baden-Württemberg zur Pflege der Erinnerung an Matthias Erzberger bei.
Lebendige Erinnerungsorte

Im Lauf der letzten Jahre gewann Erzbergers Heimat, genauer sein Geburtshaus in Buttenhausen, für die Erinnerungspolitik zunehmendes Gewicht. Institutionellen Ausdruck fand diese Entwicklung darin, dass die Stadt Münsingen das Geburtshaus Erzbergers kaufte. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg errichtete als Kooperationspartner der Stadt im Jahr 2004 dort eine moderne Ausstellung und setzte so ein Projekt um, dessen Realisierung die baden-württembergische Landesregierung 2001 sogar in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen hatte.
Anders als in der Weimarer Republik stellt inzwischen Buttenhausen den wichtigsten Erzberger-Erinnerungsort dar. Aber auch an den beiden anderen Erzberger-Erinnerungsorten im Land war das Erinnern nicht eingeschlafen. In Biberach entfalteten sich vielmehr in den letzten Jahren rege lokale Erinnerungsbemühungen. In Bad Griesbach erreicht weiterhin der Gedenkstein an der Straße eine große Zahl an Menschen.
So bleibt mit Blick auf die Gegenwart festzustellen, dass die Erinnerung an Erzberger nicht tot ist, auch wenn Politiker wie Friedrich Ebert, Konrad Adenauer oder Walther Rathenau bekannter sind als der 1921 in Griesbach ermordete Zentrumspolitiker. Wie sich dies zukünftig weiter entwickeln wird, ist nicht vorherzusagen. Dass gesellschaftliche Faktoren und das Engagement Einzelner die Entwicklung von Erinnerung stark und manchmal unvorhergesehen beeinflussen können, zeigt der Rückblick auf ein Jahrhundert Auseinandersetzungen mit und um Matthias Erzberger.
Überblick: Erinnerungsorte in Baden-Württemberg
DEMOKRATISCHE TRADITIONEN Karlsruhe - Stadt der Demokratie und des Rechts Das Stuttgarter Dreikönigstreffen |
|
GESELLSCHAFT, RELIGION, Korntal und der Pietismus in Württemberg |
KUNST UND ARCHITEKTUR |
GEFÄHRDETE DEMOKRATIE, DIKTATUR, WIDERSTAND, HOLOCAUST, ZERSTÖRUNG Erinnerungsorte an Matthias Erzberger Laupheim und seine jüdische Geschichte Von Karlsruhe nach Kislau - Schaufahrt ins KZ |
LITERATUR UND MEDIEN |
JÜNGSTE ZEITGESCHICHTE |


